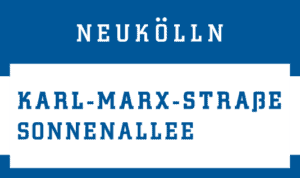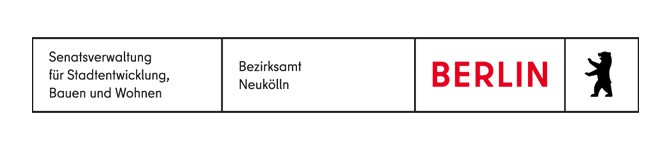Grüne Oase, Treffpunkt, Bühne
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Grüne Oase, Treffpunkt, Bühne
Mitten auf dem Kindl-Areal liegt eine grüne Insel, die weit mehr ist als nur ein Garten: Der „Vollguter Gemeinschaftsgarten“ ist ein offener Ort der Begegnung, ein liebevoll gestalteter Rückzugsraum – und zugleich Bühne für Kultur und nachbarschaftliches Miteinander. Entstanden vor acht Jahren, ist der Garten längst zu einem festen Anlaufpunkt im Kiez geworden – ohne Konsumzwang, getragen von Ehrenamt und gegenseitigem Respekt. Fabian Buntrock, Vorstandsmitglied des Zuhause e. V., der den Garten mitinitiiert hat und betreut, nimmt uns mit in diese besondere Welt zwischen Blumenbeeten und Skulpturen.
Herr Buntrock, wie entstand die Idee für den Gemeinschaftsgarten und was macht diesen Ort so besonders?
2015 konnten wir die Fläche erstmals nutzen – zunächst nur befristet, später dann dauerhaft. Möglich wurde das durch die Terra Libra Immobilien GmbH, eine Tochter der Stiftung Edith Maryon. Sie hatte damals große Teile des Kindl-Areals erworben, um sie dem Markt zu entziehen und für soziale, ökologische und kreative Nutzungen zu sichern. Für uns als gemeinwohlorientierten Kulturverein war und ist das eine große Chance. Seit unserer Gründung im Jahr 2010 setzen wir uns dafür ein, erschwingliche Räume für soziokulturelle Angebote und Nutzungen zu schaffen und zu erhalten – Orte, an denen freischaffende Künstler*innen unabhängig von Alter, Geschlecht und Religion arbeiten und sich begegnen können. Dabei geht es uns vor allem um das Miteinander: offen, respektvoll, solidarisch. Obwohl das Gelände mitsamt Garten in privatem Besitz ist, fühlt es sich an wie ein öffentlicher Raum. Genau das macht diesen Ort so außergewöhnlich. Hier ist jede und jeder willkommen.
Auf Entdeckungstour durch den „Vollguter Gemeinschaftsgarten“ (Foto: Benjamin Pritzkuleit)
Wie wird die Freifläche genutzt? Wer kommt hierher?
Der „Vollguter Gemeinschaftsgarten“ ist vieles zugleich: Treffpunkt, Rückzugsort und Bühne. Regelmäßig finden hier Konzerte statt. Außerdem organisieren wir Flohmärkte, Filmabende in Kooperation mit dem Verein filmArche und Aktionen wie gemeinschaftliches Kochen. Auch ein balinesisches Gamelan-Ensemble war schon mehrfach zu Gast. Hier ist eigentlich immer etwas los. Der Dialog mit der Nachbarschaft ist uns dabei besonders wichtig – insbesondere, wenn es um das Thema Lärm geht. Gegenseitige Rücksichtnahme und respektvoller Austausch prägen unser Miteinander. Das gilt auch für die anderen Akteur*innen, die hier am Kindl-Areal ansässig sind. Wir sind ständig in Kontakt, unterstützen uns gegenseitig und setzen gemeinsam Projekte um. So entsteht ein Ort, an dem sich ganz unterschiedliche Menschen wohlfühlen – Familien aus der Nachbarschaft, Jung und Alt, Kreative sowie Anwohnende aus benachbarten Stadtteilen. Darüber hinaus zieht der Garten auch Besucher*innen aus anderen Bezirken an. Einige von ihnen möchten hier nicht nur verweilen, sondern den Ort aktiv mitgestalten. Über unser Schwarzes Brett können Interessierte mit uns in Kontakt treten – ob mit einer Idee, einem Projekt oder einfach dem Wunsch, sich einzubringen.
Gemeinsames Kochen: Wie man sich einen Gemeinschaftsgarten so vorstellt (Foto: Zuhause e. V.)
Was braucht es, damit der Ort funktioniert?
Vor allem braucht es eine aktive, betreuende Community, Menschen, die präsent sind – nicht, um zu kontrollieren, sondern um Beziehungen mit den Gästen aufzubauen, im Gespräch zu bleiben. Die größte Herausforderung ist oft das Wetter. Mal ist es zu heiß, mal zu kalt, mal zu stürmisch. Aus ökologischer Sicht ist der Garten jedoch ein Glücksfall. Er sorgt für ein besseres Mikroklima und bietet Lebensraum für Wildbienen sowie Vögel – gelegentlich lassen sich sogar Füchse erspähen. Um den Garten klimaresilienter zu gestalten, benötigen wir jedoch dringend bessere Strukturen – etwa für die Wasserversorgung. Auch Themen wie Sauberkeit und Sicherheit spielen eine große Rolle. Zwei Platzwarte sorgen Tag für Tag für Ordnung und stehen mit den Gästen im Austausch. Immer wieder betonen wir: Dieser Garten ist ein Geschenk für Neukölln – aber er funktioniert nur, wenn alle für ihn Verantwortung übernehmen.
Ein Kurzbesuch auf Bali: Gamelan-Musik auf dem Kindl-Areal (Foto: Zuhause e. V.)
Welche Pläne gibt es für die Zukunft des „Vollguter Gemeinschaftsgartens“? Wie soll sich dieser entwickeln?
Unser Ziel ist es, den Garten langfristig als offenen, nichtkommerziellen Nachbarschaftsort zu sichern. Im Rahmen des geplanten Umbaus des VOLLGUT werden wir als Verein Teile des Gebäudes umstrukturieren und dort unter anderem offene Ateliers und Werkstätten einrichten. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für kreative Projekte und partizipative Formate, die wir noch stärker öffentlich zugänglich machen möchten.
Interview: Christoph Lentwojt, raumscript
Am Puls der Straße
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Am Puls der Straße
Ob Café, Restaurant, Späti oder Hochschule – all diese Orte prägen das Leben auf der Karl-Marx-Straße entscheidend mit. Was sie gemeinsam haben? Auch sie sind Räume der Begegnung. Hier kommen Menschen ins Gespräch – mal spontan, mal ganz bewusst. Jenseits bekannter Treffpunkte im öffentlichen Raum sind diese Einrichtungen ebenfalls wichtige soziale Anker im Kiez. Sie stiften Identität, beleben den Stadtraum und tragen dazu bei, dass das Zentrum Karl-Marx-Straße vielfältig, offen und lebendig bleibt.
Anzen Späti
Anzengruberstraße 24
Instagram: @anzenspaeti24
Foto: Carolina Crijns
Sei es, um ein Paket abzuholen, ein schnelles Wegbier zu kaufen oder doch auf ein gemütliches Feierabendgetränk zu verweilen – der Berliner Späti ist eine der wenigen Institutionen, die von Menschen aller gesellschaftlichen Hintergründe besucht werden. Zwar gibt es mittlerweile viele Spätis, die austauschbar erscheinen, doch so manch einer hat sich zu einem bereichernden Begegnungsort etabliert. So auch der Anzen Späti, der neben seiner Laufkundschaft auch viele Stammkund*innen zählt.
Das liegt einerseits daran, dass der Laden bereits seit mehr als 25 Jahren besteht. Damals handelte es sich noch um einen herkömmlichen Tabakladen, der seltene Tabakwaren und Zeitungen verkaufte. Sowohl das Graffiti an der Wand als auch das Foto im Schaufenster erinnern an die ehemalige Besitzerin Ul. Im März 2022 hat Mustafa Uyar das Geschäft übernommen, die Zeitungen durch Getränke ersetzt und so den Anzen Späti daraus gemacht. Die seltenen Tabakwaren blieben im Sortiment. Nun treffen hier Pfeifenrauchende auf Neuzugezogene.
Foto: Florentine Kwast
Doch die vielen Kund*innen kommen nicht nur wegen des Sortiments hierher. Die Nachbar*innen grüßen im Vorbeigehen und bringen selbst gekochtes Essen vorbei. Mustafa hilft ihnen beim Einladen der Autos und beim Tragen der Einkaufstaschen. Die BSR-Mitarbeitenden und Gärtner*innen bekommen jedes Mal, wenn sie vor Ort im Dienst sind, eine Wasserflasche geschenkt. „Hast du die Blumen hier gepflanzt?“, fragt der Gärtner, der den städtischen Baum vor der Tür gießt. „Na klar!“, entgegnet der Besitzer des Anzen Späti. Schnell wird klar: Mustafa ist es nicht nur wichtig, dass sich alle hier wohlfühlen. Er hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Späti zu einem Kiez-Treff etabliert hat.
Dass sich Neukölln im Wandel befindet, fällt auch Mustafa auf. Innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich im Gebiet sehr viel getan: Die Berlin School of Business and Innovation, SNIPES, das CANK und das KALLE Neukölln sind nur einige der Neueröffnungen der letzten Jahre. Davon profitiert auch der Anzen Späti, denn das bringt mehr Kundschaft. Eine der Dozentinnen der neuen Hochschule hat hier sogar ihre Abschiedsfeier gefeiert. Wenn im CANK eine Veranstaltung stattfindet, kommen viele der Gäste zum Anzen Späti, weil die Getränke hier billiger sind.
Neben dem regulären Späti-Betrieb hat hier außerdem bereits die eine oder andere Party, in Kooperation mit verschiedenen DJ-Kollektiven und Getränkeanbieter*innen (wie dem „Massage-Öl“-Bier oder Bier von Neulich), stattgefunden. Momentan wird nach einer Lösung gesucht, um solche Veranstaltungen häufiger durchführen zu können. Das wäre besonders zur Überbrückung der Wintermonate hilfreich. Kooperiert wird auch mit der Honey Lou Bar von gegenüber, die ihre selbst gemachte Dattelschorle im Anzen Späti zum Verkauf anbietet. Als einer der Barbetreiber vorbeikommt, um Hallo zu sagen, frage ich ihn, was diesen Späti so besonders macht. Ganz klar: „Die Community!“
Carolina Crijns, raumscript
La Grappa
Karl-Marx-Straße 83 A
Instagram: @lagrappa.neukoelln
Foto: Carolina Crijns
Bereits seit 40 Jahren bereiten die beiden Brüder Francesco und Andrea Smiroldo, gemeinsam mit Katherina, der Frau von Francesco, sizilianische Köstlichkeiten in Neukölln zu. Von 1984 bis 2000 betrieben sie das italienische Restaurant „La Grappa“ direkt gegenüber in der Erkstraße. Seit dem Jahr 2000 sind sie mit dem Pavillon-Café am Rathausplatz unter gleichem Namen verortet. Sie kennen Neukölln also besonders gut und haben hautnah miterlebt, wie sich der Bezirk im Laufe der Zeit verändert hat. Ende der 90er Jahre war hier beispielsweise ständig die Polizei vor Ort präsent.
Inzwischen haben sich die Umstände aber geregelt und der Rathausplatz ist, nicht zuletzt dank der Betreiber des La Grappa, zu einem Begegnungsort geworden, an dem man sich gerne aufhält. Francesco Smiroldo bezeichnet das, was sie hier am Platz leisten, als „Integrationsarbeit“ – sie bringen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Einkommensklassen zusammen und sorgen dafür, dass sich hier alle wohl, sicher und willkommen fühlen. Außerdem verschönern sie den Platz, indem sie die Wiesenfläche beim Brunnen düngen und ihre eigenen Blumen aufstellen.
Alle, die hier schon einmal verweilt haben, wissen: Auf der Terrasse des La Grappa fühlt man sich nicht nur wohl, sondern auch wie im Urlaub. Der Kaffee hat absolute Barista-Qualität und schmeckt zum hausgemachten Mandelgebäck besonders gut. Geöffnet hat das La Grappa bei Schönwetter und zwischen März und November. Aktuell finden Gespräche statt, um die Saison durch den Ausbau eines Wintergartens bis Dezember zu verlängern. Während der Wintersaison stellt die Familie Smiroldo das handgemachte Mandelgebäck übrigens für ausgewählte Geschäfte wie das KaDeWe oder das Café Einstein her. Bis dahin ist glücklicherweise jedoch noch genügend Zeit, um den Sommer am Rathausplatz zu genießen – beispielsweise mit einem Pani Cunzatu, einem typisch sizilianischen belegten Brot, oder einer Granita, einer sorbetähnlichen Süßspeise, mit Brioche. La buona vita!
Carolina Crijns, raumscript
FlyBykes
Donaustraße 40
www.flybykes.de
Frames Café
Anzegruberstraße 21
Instagram: @frames.berlin
Foto: Marius Peix
Ein leerstehender Supermarkt, ein paar gute Ideen und jede Menge Eigeninitiative: Vor rund zweieinhalb Jahren hat Öz an der Ecke Donau-/Anzengruberstraße einen Ort geschaffen, der heute weit mehr ist als ein klassischer Fahrradladen. Schon lange träumte er davon, einen Raum zu gestalten, der Werkstatt, Café und Veranstaltungsfläche miteinander verbindet. Mit FlyBykes hat er diese Idee Wirklichkeit werden lassen. Seine Erfahrung aus der Veranstaltungsbranche, in der er früher Festivals organisierte, prägt die Atmosphäre des Ortes. Das angrenzende Café namens Frames wird von seinem Partner Matthijs betrieben. Inzwischen hat sich der Ort als Treffpunkt für die Nachbarschaft mit Strahlkraft über die Umgebung hinaus etabliert.
Die Werkstatt und das Café sind durch einen offenen Durchgang miteinander verbunden. In der Mitte steht ein großer Holztisch, der tagsüber zum Coworking einlädt. Am Abend wird der Raum zur Bühne für Konzerte, Lesungen oder Tanz. Die Einrichtung trägt Spuren ihrer Geschichte – rohe Wände, alte Bodenfliesen, selbst ausgebaut im Industrial-Stil.
Foto: Marius Peix
Das Herzstück ist die Werkstatt. Durch ihre transparente Gestaltung erinnert sie an eine offene Küche in einem Restaurant. FlyBykes ist auf Lastenräder spezialisiert, bietet auf Wunsch aber auch alle anderen Fahrradtypen an. Künftig sollen ausgewählte Modelle direkt vor Ort ausgestellt werden, inklusive der Möglichkeit zur Probefahrt. Die Werkstatt wird zudem räumlich erweitert und erhält zusätzliche Selbstbedienungswände, an denen Kund*innen Fahrradzubehör entdecken und erwerben können. Zwei Mitarbeitende kümmern sich um Reparaturen, Ersatzteile und Beratung, während im Café Flat Whites, Limos und Kuchen serviert werden. Seit Kurzem gibt es auch eine kleine Außenterrasse, die das Angebot um einen sonnigen Treffpunkt im Freien ergänzt.
Die kulturellen Veranstaltungen, zu denen Singer-Songwriter-Sessions, Tanzperformances, Quiznächte und Flohmärkte gehören, zeugen von der großen Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten. Trotz dieser aus dem Kiez gewachsenen Mischung, bleibt der Charakter des Ortes erhalten. Die ungewöhnliche Verbindung von Fahrradladen und Café zeigt, wie aus einem lange ungenutzten Raum ein lebendiger, vielschichtiger Ort der Begegnung werden kann.
Marius Peix, Citymanagement
CODE University of Applied Sciences
Donaustraße 44
www.code.berlin
Instagram: @codeuniversity
Foto: CODE University
Mit rund 500 Studierenden aus 80 Ländern ist die CODE University ein Ort der interkulturellen Begegnung. Diese Offenheit spiegelt sich auch in den neuen Räumlichkeiten wider. Im August 2024 hat die englischsprachige private Hochschule ihren Standort im frisch eröffneten KALLE Neukölln bezogen. Über mehrere Etagen verteilen sich die Räume rund um ein Atrium – ein Ort zum Lernen, Arbeiten, Kollaborieren und Begegnen.
Foto: CODE University
Die Innenräume entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Studierenden und strahlen den Charakter moderner Tech-Unternehmen aus: offene Raumstrukturen, gemütliche Sitzmöbel und flexible Arbeitsbereiche. Die Seminar- und Projekträume, die durch Glaswände oder Schallschutzvorhänge voneinander abgetrennt sind, tragen von den Studierenden vergebene Namen wie „Jungle“, „Dark Matter“, „Hans Zimmer“ und „Muted“ – und vermitteln so bereits im Namen ein kreatives und inspirierendes Arbeitsumfeld. In verschiedenen Ecken bieten Spielbereiche, etwa mit Schachbrettern oder einem Tischkicker, Gelegenheit für eine kurze Auszeit. Eine große, offene Teeküche direkt neben einer weitläufigen Terrasse dient als Treffpunkt für Studierende und Lehrende – ein weiterer Baustein für das begegnungsorientierte Klima der Hochschule.
Foto: CODE University
An der CODE University stehen projektbasiertes Lernen und ein starkes unternehmerisches Netzwerk im Mittelpunkt. In drei Bachelorstudiengängen „Software Engineering“, „Business Management & Entrepreneurship“ und „Digital Design & Innovation“ werden die Studierenden von Anfang an dazu motiviert, praxisorientiert zu lernen und einen Unternehmergeist zu entfalten. Rund 14 Prozent der CODE-Studierenden und -Alumni haben bereits erfolgreich eigene Startups gegründet, berichtet Peter Ruppel, Präsident der Hochschule. Ab dem Herbstsemester 2025/26 wird zudem der Masterstudiengang „Technology & Management“ angeboten.
Foto: CODE University
Die CODE University zeigt sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen offen und neugierig. In ihren Projekten setzen sich die Studierenden mit lokalen Themen auseinander, wie etwa dem Umgang mit Straßenmüll. Eine Gruppe entwickelte das Spiel „Neuköllnopoly“, um kreative Lösungen für verschiedene Herausforderungen und Anliegen der Neuköllner*innen zu finden. Ob solche Ideen in die Praxis umgesetzt werden, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Eines ist jedoch sicher: Die CODE University macht Neukölln innovativer und lebendiger.
Saba Khanghahi, BSG
Karl-Marx-Straße – Was denkst du?
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Karl-Marx-Straße – Was denkst du?
Unsere Straße ist nicht nur Baustelle und Verkehr, sie ist vielmehr ein Ort der Begegnung. Wer regelmäßig über die Karl-Marx-Straße geht, spürt schnell: Hier bleibt man nicht nur selten allein, auch das bunte Nebeneinander macht den Ort aus. Aber wie genau wird diese Straße mit all ihren unterschiedlichen Angeboten und Facetten eigentlich genutzt? Eine Umfrage des Citymanagements mit dem Titel „Karl-Marx-Straße – Was denkst du?“ hat das genauer untersucht.
Vom 16. Oktober bis 15. November 2024 konnten Anwohnende und Besucher*innen an einer Nutzerumfrage teilnehmen. Diese wurde digital und auf der Karl-Marx-Straße durch Postkarten und Banner beworben. Zudem hatten die Teilnehmenden die Chance auf Preise aus lokalen Geschäften. Rund 750 Menschen machten mit. Besonders interessant: Die Teilnehmenden spiegeln ziemlich genau die Realität vor Ort wider. Über 80 Prozent der Befragten leben oder arbeiten in Neukölln. Die größte Altersgruppe waren Menschen zwischen 35 und 50 Jahren (42 Prozent), dicht gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen (27 Prozent).
Fragt man danach, was die Karl-Marx-Straße ausmacht, kommt fast immer: die Vielfalt. Und damit ist nicht nur das Warenangebot gemeint, sondern auch das Miteinander. Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Lebensrealitäten und Generationen treffen hier auf engem Raum aufeinander. Die Straße wird zum Spiegel ihrer Nutzenden – mal harmonisch, mal hektisch, aber immer lebendig.
Interessant ist, wie sich diese Vielfalt auch in den genannten Lieblingsorten widerspiegelt. Bei den über 65-Jährigen rangiert das Passage-Kino ganz oben, bei den 50- bis 65-Jährigen sind es die Neukölln Arcaden, genauso wie bei den 35- bis 50-Jährigen. Jüngere Menschen nennen häufiger gastronomische Orte – von jemenitischen Restaurants bis zu türkischen Frühstückscafés. Orte, an denen nicht nur gegessen, sondern auch zusammengesessen, gespielt und kennengelernt wird. Auch Treffpunkte wie SNIPES – bei den 14- bis 24-Jährigen auf Platz 1 – zeigen, dass Begegnung heute oft auch über Lifestyle und Mode passiert. Wer sich dort trifft, bleibt meist nicht allein, sondern zieht weiter – durch andere Läden, an Schaufenstern vorbei, in Richtung Essen, Kultur oder einfach vor den Späti auf ein Getränk.
Auffällig ist, wie sehr diese Straße auf vielen Ebenen genutzt wird: zum Einkaufen, zum Treffen, für Kultur, für Arztbesuche und zum Arbeiten. Ein Ort für alles – oder zumindest vieles. Und doch wird diese Offenheit auch kritisch gesehen. Viele Teilnehmende benennen Missstände: Lärm, Müll, Baustellen, Drogenkonsum, chaotischer Verkehr. Begegnungen können eben auch belasten, wenn der Raum dafür nicht gestaltet ist. Die (ehemalige) Baustelle auf der Straße, der enge Raum für Fuß- und Radverkehr, fehlende Rückzugsorte – all das erschwert die Aufenthaltsqualität, besonders für Kinder, Ältere und mobil Eingeschränkte.
Was sagt das über das Zentrum Karl-Marx-Straße aus? Dessen Motto lautet: jung, bunt, erfolgreich. Die Umfrage zeigt, dass „jung“ und „bunt“ ohne Zweifel stimmen. Aber erfolgreich? Wenn Erfolg bedeutet, dass sich Menschen begegnen können, dass sie ihre Straße als ihren Ort erleben, dann ist die Karl-Marx-Straße auf einem guten Weg. Wenn Erfolg aber nur durch neue Geschäfte, kommerzielle Nutzung und saubere Fassaden gemessen wird, bleibt dieses Bild unvollständig. Denn was viele der Teilnehmenden sich wünschen, ist nicht mehr Konsum, sondern mehr Qualität in den Begegnungen: ein sauberer Platz zum Sitzen, ein sicherer Weg zur Schule, ein Café mit Zeit statt nur mit Umsatzdruck. Eine Teilnehmerin der Umfrage sagt zum Beispiel: „Die Karl-Marx-Straße ist prall gefüllt mit Leben, egal ob auf dem Markt, im Café, in der Arztpraxis oder in den vielfältigen Kulturzentren. Menschen lieben und leben die Gemeinschaft und das Miteinander in Neukölln! Dafür braucht es dringend mehr Räumlichkeiten der Stadt, die offen für alle sind!“.
Die Umfrage liefert am Ende nicht die EINE Antwort, aber sie zeigt ein starkes Interesse an der Straße – und an ihrer Zukunft. Das Citymanagement will die Ergebnisse nun nutzen, um eine neue Webseite und eine gemeinsame Standortkampagne zu entwickeln. Ein Schritt in die richtige Richtung. Denn wenn eine Straße etwas über eine Stadt erzählt, dann ist die Karl-Marx-Straße ein Kapitel voller Stimmen. Man muss nur gut hinhören.
Tina Steinke, Citymanagement
Geschichten verbinden
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Geschichten verbinden
Der Büchertisch e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit seinen vielfältigen Angeboten zur Leseförderung für Bildungsgerechtigkeit, kulturelle Teilhabe und lokalen Zusammenhalt einsetzt. Seit 2017 ist er in der Richardstraße 83 in Rixdorf zu Hause und verfolgt dort das Ziel, den Berliner Büchertisch als Ort der Lesefreude im Kiez zu verankern.
Aktiv ist der Verein bereits seit 20 Jahren, doch erst mit dem Umzug nach Rixdorf hat eine Professionalisierung stattgefunden, die es dem Verein ermöglicht, die Weitergabe von gebrauchten Büchern durch pädagogische Angebote zu ergänzen. Nun findet man hier eine große Bandbreite an niederschwelligen Mitmach- und Bildungsformaten, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind. Durch die Kombination aus bildenden Angeboten, kiezoffenen Veranstaltungen und Ehrenamt ist dies ein Ort, an dem Menschen auf vielfältige Weise miteinander in Austausch treten und sich einbringen können.
Für Schulklassen wurden beispielsweise lehrhafte Leseangebote geschaffen, während einzelne Kinder und Jugendliche aus dem Kiez an unterschiedlichen Themen-Workshops teilnehmen können. Darüber hinaus gibt es Familiendonnerstage und Brettspielnachmittage, die von der ganzen Familie besucht werden können. Die Lesefeste und Hofflohmärkte sind weitere beliebte Veranstaltungen für alle Leseinteressierten aus dem Kiez. Und dann gibt es da noch das Flohmarktlädchen, das von 14 bis 18 Uhr eine tägliche Anlaufstelle für alle ist, die Gebrauchtbücher kaufen möchten.
Auf Entdeckungstour durch den „Vollguter Gemeinschaftsgarten“ (Foto: Berliner Büchertisch)
Für Kinder hat das Flohmarktlädchen eine besondere Funktion. Die Aktion „Ein Kind, ein Buch“ erlaubt es jungen Leser*innen, sich täglich ein kostenloses Buch mitzunehmen. In der Umgebung gibt es nämlich nicht nur viele Grundschüler*innen mit Leseschwierigkeiten, sondern auch viele, die gar keine eigenen Bücher besitzen. Gleichzeitig ist die Hemmschwelle für sie oft zu groß, um in eine Bücherei zu gehen und sich dort ein Buch auszuleihen. Die Aktion ermöglicht es jungen Lesefreudigen somit, sich im Laufe der Zeit eine eigene Bibliothek aufzubauen.
Mit dem Projekt „Rixdorf liest“ hingegen wurde ein Vorleseangebot für Schulklassen geschaffen, bei dem die Förderung sozialer Kompetenzen im Vordergrund steht. Dazu zählen beispielsweise Lesungen oder ein Bilderbuchkino für jüngere Kinder. Ein weiteres Projekt, „Zeit für Superheld*innen“, ist auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten und soll diese zur Mitgestaltung im Kiez anregen. Es handelt sich hierbei um ein mehrteiliges Workshop-Format, in dem die Themen partizipativ von den Teilnehmenden entwickelt werden und somit zur Persönlichkeitsstärkung beitragen sollen. In diesem Rahmen haben bereits Müllsammelaktionen, Besuche im Altersheim und Workshops zu persönlichen Alltagsheld*innen stattgefunden.
Die beiden Ehrenamtlichen Lucas und Uta bei ihrem gemeinsamen Dienst im Flohmarktlädchen (Foto: Carolina Crijns)
Neben der Förderung des Lesens und der Selbstermächtigung ist es dem Verein bei seinen Tätigkeiten vor allem wichtig, das soziale Miteinander in der Nachbarschaft angenehmer zu gestalten. So finden auch für die 50 im Verein engagierten Ehrenamtlichen monatliche Treffen statt. Diese bestehen aus einer bunt gemischten Gruppe von Studierenden, Drehbuchautor*innen, Richter*innen, Lehrpersonen oder Rentner*innen und vielen mehr. Gemeinsam betreiben sie das Flohmarktlädchen, nehmen Bücherspenden an, sortieren diese, packen Spendenkisten für Schulen und Kitas, lesen Kindern bei Veranstaltungen vor, basteln mit ihnen oder befüllen den öffentlichen Bücherschrank am Alfred-Scholz-Platz. Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, sind also vielfältig. Wer Teil davon werden möchte, kann sich jederzeit beim Verein melden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Berliner Büchertisch auch finanziell oder nach Absprache durch Spenden von gut erhaltenen Büchern, CDs, Schallplatten, Spielzeug oder Brettspielen zu unterstützen.
Im Projektraum des Büchertisch e. V. geht es immer wieder bunt zu (Foto: Zuhause e. V.)
Bei den zahlreichen unterschiedlichen Angeboten des Vereins geht es letztlich vor allem darum, mehr Menschen eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Denn wer nicht lesen kann, kann sich auch nicht in gleichem Maße an ihr beteiligen. Abgesehen vom Bildungsauftrag wird durch das Erschließen imaginativer Welten auch die Vorstellungskraft gestärkt, was vor allem in Zeiten, in denen Entwicklungen festgefroren scheinen, von großer Bedeutung ist. Zudem kann durch den Austausch von Geschichten und Büchern das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden. Denn auch in einer zunehmend digitalen Welt sind Geschichten immer noch das, was Menschen miteinander verbindet.
Carolina Crijns, raumscript
Sich selbst und anderen begegnen
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Sich selbst und anderen begegnen
Wo begegnen sich Kinder und Jugendliche, unabhängig von Religion, Geschlecht, Herkunft und sozialer Zugehörigkeit? Wo sozialisieren sie sich? Neben Schulen übernehmen diese Rolle vor allem Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Im Zentrum Karl-Marx-Straße können junge Menschen diese im Blueberry und dem Rahim-Yildirim-Haus in Anspruch nehmen.
Der gemeinnützige Träger Outreach bietet in der Reuterstraße 9–10 bereits seit 2007 offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit an. Während das neu eröffnete Blueberry allen Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren offensteht, heißt das Nachbargebäude Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren willkommen. Mit dem Neubau des Blueberry und der Erweiterung der Außenanlagen im Jahr 2024 konnte der hohe Bedarf an Jugend- und Sozialeinrichtungen im Kiez zumindest teilweise gedeckt werden.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit versteht sich als ein freiwilliges Angebot für junge Menschen, das von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet wird. Das Ziel ist es, sie zur Selbstbestimmung zu befähigen. Außerdem sollen sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung motiviert werden. So wird in beiden Einrichtungen in der Reuterstraße in monatlich stattfindenden Vollversammlungen gemeinschaftlich über das Wochenprogramm und die Anschaffungen abgestimmt. Auch die Hausregeln wurden zu Beginn gemeinsam von den Kindern und Jugendlichen festgelegt.
Das neu gebaute Blueberry während der Eröffnungsfeier
Sozialarbeiter Jens Schielmann sieht in den Kindern also gewissermaßen seine Auftraggebenden. Darüber hinaus definiert er seine Arbeit als beziehungspädagogisch. Das bedeutet, dass es darum geht, Vertrauen zu den einzelnen Kindern aufzubauen, ihre Problemlagen zu erkennen und ihre Talente zu fördern. Bei dem großen Andrang an Kindern ist es oft jedoch nicht leicht, Zeit zu finden, um auf jedes der Kinder im Einzelnen einzugehen, da man ständig mit den akuten Bedürfnissen der vielen Besucher*innen vor Ort konfrontiert ist.
Zusätzlich zur offenen Kinder- und Jugendarbeit wird sowohl im Blueberry als auch im Rahim-Yildirim-Haus eine bedarfsorientierte Unterstützung angeboten. Im Blueberry wird das in Kooperation mit der Helene-Nathan-Bibliothek umgesetzt. Das Lerncoaching unterstützt die Kinder bei Schulaufgaben, bei Prüfungsvorbereitungen oder auch bei der Praktikumssuche. Im Jugendhaus hingegen wird das Angebot von Outreach in Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen umgesetzt, denn hier finden neben offener Jugendarbeit auch Angebote der Jugendsozialarbeit statt. Diese unterscheidet sich von der offenen Jugendarbeit dahingehend, dass sie zu gezielten Themen und Zeiten Angebote für Jugendliche bereitstellt, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Dies kann unter anderem Gewaltprävention beinhalten, aber auch Unterstützung bei Bewerbungen oder der Berufsorientierung – beispielsweise in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit oder dem Jobcenter.
Im Blueberry wird regelmäßig gemeinsam gekocht und gegessen (Foto: Jens Schielmann)
Den wichtigsten Aspekt seines gesellschaftlichen Auftrags sieht Jens Schielmann jedoch darin, dass sich die Kinder und Jugendlichen stets wertgeschätzt fühlen und mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert wird. Damit stellt die Jugend(sozial)arbeit auch einen klaren Gegensatz zur stark hierarchisch strukturierten Schule dar. Durch das Vertrauen, das Sozialarbeitende im Laufe der Zeit aufbauen, stellen sie schließlich auch wichtige Vertrauenspersonen für junge Menschen dar, mit denen sie ihre Anliegen und Sorgen teilen können, die sie sich in der Schule oder zu Hause nicht anzusprechen trauen. Meist sind dies Themen wie die erste Liebe, die erste Regelblutung oder Stress in der Familie beziehungsweise der Schule. Darüber hinaus sind die Pädagog*innen auch darin geschult, tiefgreifendere Probleme wie Missbrauch zu erkennen.
Musikalischer Auftritt während des 23-Nisan-Kinderfestes („23 Nisan“ steht für den 23. April und wird in der Türkei als bedeutsamer Kindertag gefeiert, Foto: Nele Hecht)
Die standortgebundene Kinder- und Jugendarbeit, wie sie im Blueberry und dem „Rahim-Haus“ angeboten wird, leistet neben der Schule und der Familie also einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Austausch junger Menschen. Im Idealfall gelingt es ihr, soziale Barrieren abzubauen und jungen Erwachsenen abseits von ihren sozialen Hintergründen ein Gefühl von Teilhabe, Zugehörigkeit und sozialem Miteinander zu geben. Hier können sie, unabhängig von ihrer Erziehung, für sich herausfinden, was es für sie bedeutet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Durch die frühe Vermittlung eines Demokratieverständnisses lernen sie, aufeinander Acht zu geben und respektvoll miteinander umzugehen. Fest steht: Hier sind junge Menschen in ihrer Vielfalt nicht nur willkommen, sondern auch eingeladen, sich gegenseitig sowie sich selbst (neu) zu begegnen.
Carolina Crijns, raumscript
Bibliotheken bauen Brücken
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Bibliotheken bauen Brücken
Während Bibliotheken für so manche als Begegnungsorte schlechthin gelten, gibt es dennoch viele Menschen, die selten oder sogar noch nie eine betreten haben. Die einen sehen sie als willkommensoffene Häuser, doch andere empfinden eine imaginäre Hemmschwelle. Haben einige noch das Bild einer alteingesessenen Institution vor Augen, so können andere bestätigen, dass sich moderne Bibliotheken in den letzten Jahrzehnten in ihrer Ausstattung und ihren Angeboten stark weiterentwickelt haben. Wie versteht die Helene-Nathan-Bibliothek in diesem Kontext ihre Rolle als Bezirkszentralbibliothek von Berlin-Neukölln?
Umbrüche gibt es zurzeit sehr viele. Auch Bibliotheken sind den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen ausgesetzt und befinden sich dadurch stark im Wandel. Vor allem die zunehmende Privatisierung öffentlicher Orte und die damit einhergehende Konsumpflicht setzen Städte enorm unter Druck. Denn dadurch werden die Hürden, sich am öffentlichen Leben beteiligen zu können, immer größer. Um diese Lücke zu füllen, werden Bibliotheken zunehmend in der Verantwortung gesehen, sich zu möglichst offenen Begegnungsorten zu entwickeln.
Die Gründe, warum sich Bibliotheken besonders gut als niederschwelliger Kiez-Treffpunkt eignen, sind vielfältig: Man muss sich hier weder anmelden noch ausweisen, erklären oder für den Aufenthalt zahlen. Vor allem während der Wintermonate wird deutlich, wie sehr es an solchen Orten in Nord-Neukölln mangelt. So verabreden sich beispielsweise Kleinfamilien in der Kinderbuchabteilung, um den Samstagvormittag gemeinsam zu verbringen.
Die Helene-Nathan-Bibliothek sieht ihre Aufgabe, möglichst allen offen zu stehen, auch darin, ihr Programm so vielfältig wie möglich auszurichten. Regelmäßig und mehrfach in der Woche finden Angebote für Kitas und Schulen statt. Zu den abwechslungsreichen Angeboten zählt darüber hinaus auch das Sprachcafé, bei dem sich Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, auf Deutsch miteinander unterhalten können, um die Sprache direkt in ihrem alltäglichen Gebrauch anzuwenden. Im Rahmen des Projekts „Digital-Zebra“ wird Hilfestellung im Umgang mit digitalen Geräten, dem Internet oder digitalen Formularen angeboten. Beim Jobcafé werden Menschen bei der Jobsuche beraten. Zudem gibt es viele Vorträge zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel: Wie verhält man sich im Sommer am besten bei Hitze? Das Lerncoaching, das auch im Blueberry angeboten wird, unterstützt Schüler*innen bei den Hausaufgaben und bei der Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus werden zahlreiche kreative Kurse angeboten, darunter Schreib-, Theater-, Comic- und Näh-Workshops.
Bei der Programmausrichtung stehen im Wesentlichen zwei Aspekte im Vordergrund: Einerseits sollen die Menschen in ihrer Selbstermächtigung gestärkt werden, um ihren Alltag leichter bewältigen zu können. Dies kann durch das Aneignen neuer Fähigkeiten oder Kenntnisse gefördert werden. Andererseits soll Neugier geweckt werden. In den Kursangeboten kann man sich neuen Dingen auf spielerische Weise annähern, muss kein Vorwissen mitbringen und kann auch einfach mal etwas ausprobieren, ohne vorher viel Geld für Materialien oder Utensilien ausgeben zu müssen.
Außerdem bemüht sich die Bibliothek aktiv, neue Zielgruppen zu erreichen und ihre Angebote einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei setzt sie auf Kooperationen – etwa mit den Stadtteilmüttern –, um Brücken in den Stadtteil zu schlagen. Indem diese Partner*innen ihre kiezoffenen Veranstaltungen in der Bibliothek und aufsuchend durchführen, entsteht Kontakt zu Menschen, die zuvor kaum Berührung mit dem Ort hatten. War dieses Publikum einmal vor Ort, ist die Hemmschwelle geringer, beim nächsten Mal auch allein zu kommen. Im Grunde geht es darum, die Bibliothek als Begegnungs- und Verweilort für ein größeres Publikum erlebbar zu machen.
Die Helene-Nathan-Bibliothek als einzige öffentliche Bibliothek in Nord-Neukölln stößt in all ihrem Engagement trotzdem auch an Grenzen. Um den nötigen Bedarf ausreichend zu decken, bräuchte sie beispielsweise weitaus mehr Nutzungsfläche. Zudem fehlt ohne ein berlinweites Bibliotheksgesetz der rechtliche Rahmen, der Kürzungen erschweren und Angebote noch stärker und langfristig absichern könnte.
Mit Blick in die Zukunft wünschen sich die Bibliotheksleiterin Claudia Lumpe und die Community-Managerin Franziska Vorwerk-Laabs, auch weiterhin ein so dichtes und abwechslungsreiches Angebot auf die Beine stellen zu können. Zudem möchten sie noch mehr Menschen für ihre Angebote gewinnen. Auch in Zukunft soll die Bibliothek als Ort der Offenheit, an dem Vielfalt geschätzt und ein respektvoller Umgang miteinander gelebt wird, bestehen bleiben.
Carolina Crijns, raumscript
Zwischen Alltag und Aktionen
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Zwischen Alltag und Aktionen
Der Alfred-Scholz-Platz ist das Herzstück der Karl-Marx-Straße und vor allem eines: vielfältig. Er lädt dazu ein, für einen Moment innezuhalten, Freund*innen zu treffen oder neue Bekanntschaften zu knüpfen. Und hin und wieder verwandelt sich der Platz in weit mehr als das und sorgt mit Musik, Kunst und weiteren Aktionen für Abwechslung.
Seit Jahren beleben Morris Perry und Philip Schmidt vom Spotlight Talent e. V. die Platzfläche aktiv mit. Was einst mit „Alfreds Fest“ begann – einem Nachbarschaftsfest mit Live-Musik, Varieté und einer langen Tafel – entwickelte sich weiter zum „RIXPOP Musikfestival Neukölln“, bei dem junge Musiker*innen sowie Kulturschaffende ihr Können vor breitem Publikum unter Beweis stellen konnten. Der Clou dabei: eine Pop-up-Bühne, mit der auch andere Orte im Bezirk punktuell bespielt wurden. Die Pandemie und der Umbau der Karl-Marx-Straße bremsten das Format aus. Seit 2023 lebt der Platz mit den „RIXPOP Sessions“ wieder auf – als Open-Air-Bühne mit professionellem Soundsystem und stimmungsvoller Lichtinstallation.
Auch während des Musikfestivals „Fête de la Musique“ ging es musikalisch und ereignisreich zu
Die meisten Singer-Songwriter*innen und Bands, die hier auftreten, sind junge, internationale Musiker*innen, von denen viele neu in der Berliner Musikszene sind. Einige kommen gerade von der Musikschule, haben ihre Bands während des Studiums gegründet oder ihre Solokarrieren aufgebaut und sind auf der Suche nach geeigneten Auftrittsmöglichkeiten. Die „RIXPOP Sessions“ bieten genau diese Bühne – mit Erfolg: Die Veranstaltungen erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Zu den Besucher*innen zählen Menschen unterschiedlichsten Alters, die längst nicht mehr nur aus der direkten Umgebung kommen. Freundeskreise, Fangemeinden und ganze Communities folgen den Acts und verleihen den Veranstaltungen so eine unvergleichliche Atmosphäre.
Aufgrund der zentralen Lage des Platzes sind im Vorfeld Absprachen wichtig – vor allem, um etwaige Lärmbelästigungen zu vermeiden. Der Kompromiss: ruhige Klänge zu Beginn, kraftvolle Töne später. „Hier findet echter Austausch statt – Anteilnahme, und manchmal auch Auseinandersetzung“, sagt Perry. Es gehe darum, Brücken zu bauen – zwischen Menschen, zwischen Kulturen. Denn Straßenkultur kann mehr als unterhalten, sie verbindet. Dafür braucht es Orte wie den Alfred-Scholz-Platz. Perry und Schmidt wünschen sich, dass der Platz nicht nur weiterhin bespielt, sondern weitergedacht wird: als Raum für Ideen und Ort gelebter Vielfalt.
Die „RIXPOP Sessions“ ziehen regelmäßig zahlreiche Musikfans an (Foto: Rebekka Brather)
Auch beim Festival „48 Stunden Neukölln“ wird der Platz regelmäßig zur Bühne und zum Ausstellungsraum, wie Katarzyna Nowak und Alexandra Flindris vom Kulturnetzwerk Neukölln e. V. eindrucksvoll schildern. Beide sind seit 2023 für die Planung des stadtweit bekannten Kunstfestivals zuständig. In diesem Jahr lautete das Motto „WTF (what the fact)? Zwischen Wahrheit und Wahrnehmung“. Über 250 Orte wurden bespielt, darunter auch der Alfred-Scholz-Platz mit spektakulären künstlerischen Beiträgen. Besonders imposant: Das „Aleph“, eine begehbare, aufblasbare Installation von Paula Vidal, die eine fragmentierte 360-Grad-Perspektive auf die Umgebung bot. Darüber hinaus zierte die Skulptur „DIAMANT“ von Alice Bischof den Platz. Performances, darunter auch eine von Krzysztof „Leon“ Dziemaszkiewicz (siehe Titelbild der Ausgabe), lockten weitere Interessierte an. Einmal mehr zeigte sich: Kunst im öffentlichen Raum wirkt – sie berührt, irritiert, inspiriert. Und sie bringt Menschen ins Gespräch. Auch deshalb zieht das Festival von Jahr zu Jahr mehr Besucher*innen an.
Schon gewusst?
Der Alfred-Scholz-Platz hat eine eigene Webseite. Auf dieser finden sich alle wichtigen Informationen rund um den Platz. Dort steht auch, was nötig ist, um eigene Ideen und Aktionen vor Ort Wirklichkeit werden zu lassen.
Für Nowak und Flindris ist der Alfred-Scholz-Platz ein offener und lebhafter Ort, an dem unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen und immer wieder Neues entsteht. Besonders in den Abendstunden, wenn die Sonne durch die Werbellinstraße scheint, entfaltet er seine ganze Magie. Gleichzeitig betonen sie, dass es genauso wichtig ist, neue, weniger bekannte Räume zu aktivieren und künstlerisch zu bespielen, um neue Perspektiven zu eröffnen. Dabei verweisen sie auf die Bedeutung von Kulturräumen und Ateliers, die jedoch zunehmend von Schließungen bedroht sind.
Obwohl die Aktionen auf dem Platz zeitlich begrenzt sind, ist ihre Wirkung nachhaltig. Sie machen aus ihm mehr als nur einen Durchgangsort. Gleichzeitig ist der Platz ein Ort der Gegensätze: Ruhepol und Bühne, Rückzugsraum und Treffpunkt. Dass er funktioniert, liegt vor allem an den Menschen, die ihn tagtäglich gestalten – mit ihrer Kreativität, ihrem Engagement, ihrer Offenheit. Ohne sie wäre dieser Ort nicht das, was er heute ist. In diesem Sinne: Sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Alfred-Scholz-Platz ein Ort bleibt, den wir schätzen, und entwickeln wir ihn zusammen weiter!
Christoph Lentwojt, raumscript
Begegnungen
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Begegnungen
In Zeiten, in denen gesellschaftlicher Austausch zunehmend digital sowie polarisierend stattfindet, gewinnen physische Orte, an denen gruppenübergreifende Begegnungen möglich sind, vermehrt an Bedeutung. Wir haben uns im Zentrum Karl-Marx-Straße auf die Suche nach solchen immer rarer werdenden Begegnungsorten gemacht.
Liebe Leser*innen,
was wäre eine Stadt ohne sozialen Austausch? Eine Demokratie ohne Teilhabe? Ein Kiez oder ein Stadtzentrum ohne Gemeinschaftsgefühl? Sie wären allesamt sicherlich trostlos. Orte, die diese Formen des Miteinanders ermöglichen, sind das Fundament einer lebendigen Stadt. Sie sind der Nährboden, auf dem Gemeinschaft entstehen kann – in kleinen, alltäglichen Momenten ebenso wie im stadtgesellschaftlichen Dialog.
Sie sorgt für Belebung und Begegnungen im öffentlichen Raum: die Außenterrasse des La Grappa (Foto: Benjamin Pritzkuleit)
Doch steigende Mieten und wachsender Wettbewerbsdruck erschweren zunehmend den Zugang zu solchen Orten. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist es jedoch entscheidend, miteinander im Austausch zu bleiben – und zwar, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Gerade in der heutigen Zeit, in der sich Gruppen zunehmend abzuspalten scheinen, ist es notwendiger denn je, Brücken zu bauen.
Die Sanierung des Gebiets Karl-Marx-Straße/Sonnenallee endet nicht mit fußgängerfreundlichen Straßen oder erneuerten Fassaden. Es sind die Menschen, die die sanierten Plätze und Gebäude nutzen und mit Leben füllen, die sie zu Orten des Miteinanders machen. Sie sind es, die Gemeinschaft im Zentrum Karl-Marx-Straße nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar machen.
Mit der diesjährigen Ausgabe des BROADWAY zum Thema „Begegnungen“ richten wir unseren Blick auf Orte rund um die Karl-Marx-Straße, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Image- und Identifikationsort für den Bezirk. Es soll auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein. Sei es an öffentlichen Plätzen wie dem Alfred-Scholz-Platz oder in halböffentlichen Gebäuden wie der Helene-Nathan-Bibliothek und dem Kinder- und Jugendtreff Blueberry. Sei es an Orten, die von Vereinen gepflegt werden, wie dem „Vollguter Gemeinschaftsgarten“ des Zuhause e. V. oder in den Räumlichkeiten des Büchertisch e. V.; aber auch Lokale wie das La Grappa oder der Anzen Späti. Sie alle nehmen eine gesellschaftsverbindende Rolle ein und stärken durch ihr Angebot und ihre willkommensoffene Kultur die Teilhabe und das Gemeinschaftsgefühl im Kiez.
Damit heben wir schließlich auch die Bedeutung dieser Orte für das Zentrum der Karl-Marx-Straße hervor. Denn es sind genau diese Räume, die der Gesellschaft von morgen Zukunft geben. Ich danke allen, die sich mit Engagement, Kreativität und Ausdauer für ein vielfältiges, inklusives und offenes Zentrum Karl-Marx-Straße einsetzen. Möge dieses Heft inspirieren, Mut machen und zum Mitmachen einladen!
Ihr Jochen Biedermann
Stadtrat für Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr
Broadway Nº 16
Die 16. Ausgabe ist dem Thema „Begegnungen“ gewidmet und hebt die Bedeutung von Orten hervor, an denen Menschen in ihrer Vielfalt zusammenkommen können. Denn ein funktionierendes Zentrum ist mehr als nur ein wichtiger Imagefaktor für den Bezirk. Es soll auch ein Ort des Austauschs sein – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung sowie sozialer und religiöser Zugehörigkeit. Im Zuge dessen werden Orte rund um die Karl-Marx-Straße vorgestellt, an denen Gemeinschaft erlebbar wird: im öffentlichen Raum, in öffentlichen Einrichtungen, in Vereinen ebenso wie in Lokalen. Sie alle bergen das Potenzial, eine gesellschaftsverbindende Rolle einzunehmen, was gerade in der heutigen Zeit von immer größerer Bedeutung ist.
Stand August 2025
Begegnungen
In Zeiten, in denen gesellschaftlicher Austausch zunehmend digital sowie polarisierend stattfindet, gewinnen physische Orte, an denen gruppenübergreifende Begegnungen möglich sind, vermehrt an Bedeutung. Wir haben uns im Zentrum Karl-Marx-Straße auf die Suche nach solchen immer rarer werdenden Begegnungsorten gemacht. Weiterlesen…

Zwischen Alltag und Aktionen
Der Alfred-Scholz-Platz ist das Herzstück der Karl-Marx-Straße und vor allem eines: vielfältig. Er lädt dazu ein, für einen Moment innezuhalten, Freund*innen zu treffen oder neue Bekanntschaften zu knüpfen. Weiterlesen…

Sich selbst und anderen begegnen
Wo begegnen sich Kinder und Jugendliche, unabhängig von Religion, Geschlecht, Herkunft und sozialer Zugehörigkeit? Wo sozialisieren sie sich? Neben Schulen übernehmen diese Rolle vor allem Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Weiterlesen…

Bibliotheken bauen Brücken
Während Bibliotheken für so manche als Begegnungsorte schlechthin gelten, gibt es dennoch viele Menschen, die selten oder sogar noch nie eine betreten haben. Die einen sehen sie als willkommensoffene Häuser, doch andere empfinden eine imaginäre Hemmschwelle. Weiterlesen…

Geschichten verbinden
Der Büchertisch e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit seinen vielfältigen Angeboten zur Leseförderung für Bildungsgerechtigkeit, kulturelle Teilhabe und lokalen Zusammenhalt einsetzt. Weiterlesen…

Karl-Marx-Straße – Was denkst du?
Unsere Straße ist nicht nur Baustelle und Verkehr, sie ist vielmehr ein Ort der Begegnung. Wer regelmäßig über die Karl-Marx-Straße geht, spürt schnell: Hier bleibt man nicht nur selten allein, auch das bunte Nebeneinander macht den Ort aus. Weiterlesen…

Am Puls der Straße
Ob Café, Restaurant, Späti oder Hochschule – all diese Orte prägen das Leben auf der Karl-Marx-Straße entscheidend mit. Was sie gemeinsam haben? Auch sie sind Räume der Begegnung. Hier kommen Menschen ins Gespräch – mal spontan, mal ganz bewusst. Weiterlesen…

Grüne Oase, Treffpunkt, Bühne
Mitten auf dem Kindl-Areal liegt eine grüne Insel, die weit mehr ist als nur ein Garten: Der „Vollguter Gemeinschaftsgarten“ ist ein offener Ort der Begegnung, ein liebevoll gestalteter Rückzugsraum – und zugleich Bühne für Kultur und nachbarschaftliches Miteinander. Weiterlesen…
Grußwort 2024
Dies ist ein Artikel ist aus dem KARLSON #11 – 2024, der Zeitung für das Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee.
Stand November 2024
Grußwort
Liebe Leser*innen,
ich freue mich, Ihnen die 11. Ausgabe der Sanierungszeitung KARLSON vorstellen zu können, in der wir Sie wie gewohnt über aktuelle Entwicklungen, Sanierungsvorhaben sowie -planungen im Lebendigen Zentrum und Sanierungsgebiet Karl-Marx-Straße/Sonnenallee informieren.
Der Klimawandel und seine Folgen betrifft uns alle und auch für Berlin stellen sich damit ganz neue Herausforderungen. Ist schon lange klar, dass wir Menschen im Winter vor Kälte schützen müssen, ist der Hitzeschutz im Sommer ein vergleichsweise neues Thema. Doch insbesondere für vulnerable Gruppen sind die vermehrt auftretenden Hitzetage eine zunehmende gesundheitliche Belastung. Aus diesem Grund hat das Bezirksamt Neukölln einen Hitzeschutzplan erarbeitet, der mit verschiedenen Ansätzen längere Hitzeperioden erträglicher machen will.
Auch die Neugestaltung des Karl-Marx-Platzes denkt die zunehmenden Extremwetterereignisse mit. Eine Antwort darauf liegt im Entwässerungskonzept, mittels dessen zumindest ein Teil des Regenwassers künftig direkt vor Ort versickern kann. Das stärkt das Grundwasser und kühlt den Platz. Neben dem Klima stellt auch der Marktbetrieb besondere Anforderungen an das zukünftige Erscheinungsbild des Platzes. Nikolaus Fink von den Marktplanern schildert in einem Interview, welche Chancen der Umbau für den Markt und den Kiez mit sich bringt.
Ein freudiges Ereignis stellte im September die Einweihung des Neubaus des Kinder- und Jugendtreffs Blueberry in der Reuterstraße dar. Die bunte Eröffnung hat gezeigt, welche wichtige Leerstelle eines Freizeit- und Lernorts das Blueberry nun füllt. Auch bei den Planungen zur Umgestaltung des Schulhofs der Elbeschule spielt die Farbe Blau aufgrund des aufgegriffenen Themas Wasser eine große Rolle. Hier wird die Aufenthaltsqualität verbessert und im Rahmen des Beteiligungsprozesses waren die Schülerinnen und Schüler eingeladen, am Entwurf mitzuwirken.
Das Modellprojekt Campus Rütli mit seinen vielfältigen Angeboten und qualitätsvollen Freiräumen wiederum zeigt, wie sich Schule und Quartier verknüpfen lassen. Der diesjährige historische Artikel beschäftigt sich mit dem pädagogischen Ansatz der Lebensgemeinschaftsschule, der vor gut 100 Jahren am Schulstandort in der Rütlistraße verfolgt wurde. Bereits damals wurden neue pädagogische Ansätze gelebt, die weit über die Grenzen des Bezirks hinaus bekannt wurden.
Außerdem können Sie sich auf spannende neue Einblicke rund um das VOLLGUT-Gelände freuen. Denn seit dem Werkstattverfahren zur städtebaulichen Entwicklung des Komplexes im Jahr 2021 hat sich einiges getan. Seien Sie gespannt, welche Nutzungen sich ansiedeln werden und wie sich das Projekt zur Nachbarschaft öffnen möchte.
Viel Freude beim Lesen!
Jochen Biedermann
Stadtrat für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Jochen Biedermann (© Susanne Tessa Müller)
Ansprechpartner
Bezirksamt Neukölln
Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Stadtplanung
Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin
Tel.: 030 – 90 239 2153
stadtplanung(at)bezirksamt-neukoelln.de
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen IV C 32
Anke Heutling
Württembergische Straße 6-7, 10707 Berlin
Tel.: 030 – 90 173 4914
anke.heutling(at)senstadt.berlin.de
BSG Brandenburgische
Stadterneuerungsgesellschaft mbH
Sanierungsbeauftragte des Landes Berlin
Karl-Marx-Straße 117 , 12043 Berlin
Tel.: 030 – 685 987 71
kms(at)bsgmbh.com
Lenkungsgruppe
der [Aktion! Karl-Marx-Straße]
lenkungsgruppe(at)aktion-kms.de
Citymanagement
der [Aktion! Karl-Marx-Straße]
Richardstraße 5, 12043 Berlin
Tel.: 030 – 22 197 293
cm(at)aktion-kms.de